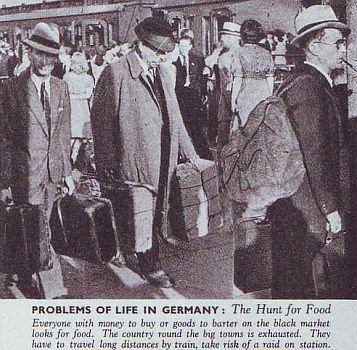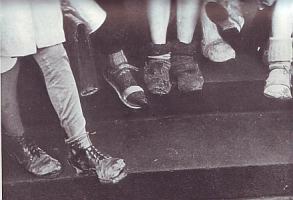Die Schwarzmarktzeit 1945-1948
.
Die Situation nach dem Krieg
Während des Übergangs vom Krieg zum Frieden, erlebte die
zivile Bevölkerung in Deutschland zunächst ein Vakuum, eine Art
„Niemandszeit“. Die alten Löhne wurden nicht mehr bezahlt, die neuen
waren noch nicht in Aussicht gestellt. Die alten Lebensmittelkarten waren
ungültig, neue waren noch nicht ausgegeben worden. Die Betriebe, Läden
und Banken waren geschlossen.
.
| Die einzige Möglichkeit, an Lebensmittel und dringend benötigte
Kleidung und Gebrauchsgegenstände zu kommen, war in dieser Zeit der
Schwarzmarkt. Er war überlebensnotwendig geworden, vor allem für
die Stadtbevölkerung, die kaum eine andere Möglichkeit hatte,
sich selbst zu versorgen.
Auch als die Besatzer die öffentliche Ordnung wieder hergestellt
hatten, und es wieder Lebensmittelkarten und Bezugsscheine gab, war die
Versorgungssituation weiterhin äußerst prekär. Der Mangel,
der schon während des Krieges beträchtliche Ausmaße angenommen
hatte, verschärfte sich nach dem Krieg sogar noch auf katastrophale
Weise. |
.. |

Lebensmittel gegen Schuhe.
Schwarzmarktszene in Hamburg |
.
Die vor dem Krieg angefüllten Vorratskammern waren nun leer
und es gab keine Lieferungen mehr aus den ehemals besetzten und neutralen
Gebieten. Aufgrund der immensen Kriegszerstörungen gelang es nur sehr
schleppend, die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. Chronische Versorgungslücken
sorgten dafür, dass der Schwarzhandel immer mehr zu einer unverzichtbaren
Ergänzung der offiziellen Planwirtschaft wurde.
.
 "Stoppeln": Hungrige Städter durchsuchen
das abgeernte Feld nach übriggebliebenen Kartoffeln
"Stoppeln": Hungrige Städter durchsuchen
das abgeernte Feld nach übriggebliebenen Kartoffeln
|
... |
Besonders die landwirtschaftliche Produktion verzeichnete
nach dem Krieg erhebliche Einbußen hervorgerufen durch Gebietsverluste,
Mangel an Dünger jeder Art, durch Vieh- und Maschinenverlusten, Arbeitskräftemangel,
Kriegszerstörung, fehlende Betriebsmittel, etc.
Deutschland war nicht in der Lage die Nahrungsmittelversorgung für
seine Bevölkerung aus eigener Kraft zu leisten. |
.
Die Versorgung mit Lebensmitteln sollte in den folgenden Nachkriegsjahren
zu einem Hauptproblem werden.
Die Lebensmittelrationen für die Bevölkerung lagen weit
unter dem physischen Existenzminimum von 2000 Kalorien pro Tag (für
Normalverbraucher). 1946 und 1947 sanken sie in manchen Bereichen Deutschlands
sogar auf unter 900 Kalorien pro Tag. Selbst noch 1948 wurden die angestrebten
1500 Kalorien Tagesration selten erreicht.
Rechtes Bild: Aus einem Zeitungsbericht der "Picture
Post" , 31. August 1946. |
... |
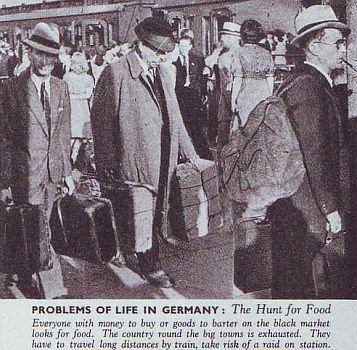 |
.
 Gemüseanbau vor den Ruinen des Brandenburger
Tors, Berlin Sommer 1946.
Gemüseanbau vor den Ruinen des Brandenburger
Tors, Berlin Sommer 1946.
|
.. |
Als Maßnahme der Selbsthilfe wurden Städter auch selbst
zu Bauern. Von den Behörden wurden Grünanlagen und ehemalige
Militärgelände als Kleingartenanlage zur Verfügung gestellt.
Vierhundert Morgen des Berliner Tiergartens wurden auf diese Weise bewirtschaftet.
Alles Essbare wurde verwertet unter anderem Frösche, Schnecken,
Beeren, Eicheln, Brennesseln, Pilze und Löwenzahn. Not- und Ersatzrezepte
waren an der Tagesordnung. So gab es Ersatzwurst aus Fisch, Torte aus Kaffeesatz,
Suppe aus Futterrüben. |
.
Eine ausreichende Nahrungsmittelversorgung konnte durch solche Maßnahmen
allerdings nicht gewährleistet werden. Aber zumindest half es, hier
und da die größte Not ein wenig zu lindern.
.
| Die permanente Mangelversorgung mit Lebensmitteln führte bei
weiten Teilen der Bevölkerung zu extremer Unterernährung und
Hungerödemen.
Besonders lebensgefährlich war die Situation für Säuglinge,
Alte und Kranke. Zahlreiche Krankheiten wie Tuberkulose, Wassersucht und
Osteoporose breiteten sich aus. Kinder litten oft an Rachitis und Krätze. |
... |
 Unterernährte Kinder einer Düsseldorfer Schule,
1946
Unterernährte Kinder einer Düsseldorfer Schule,
1946 |
.
Die mangelnde Ernährung führte zu einer rapiden Abnahme
der Arbeitsleistung. Neben körperlichen Folgen führte sie auch
zu einer Reihe psychischer Störungen. Viele litten unter Konzentrationsschwäche
und Gedächtnisproblemen. Der Hunger führte auch zu einer zunehmenden
Aggressivität und asozialem Verhalten. Die Selbstmordrate war hoch
wie nie.
.
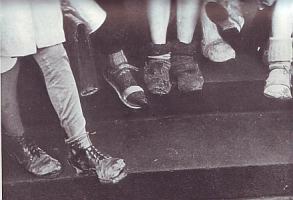 "Schuhe" von Schulkindern in Hamburg, 1946
"Schuhe" von Schulkindern in Hamburg, 1946
|
.. |
Bereits zwei Jahre vor Ende des Krieges war die Versorgung der Bevölkerung
mit Kleidung eingestellt worden. Dieses hatte schon während des Krieges
zu einem enormen Mangel an Textilwaren und Schuhen geführt.
Nach dem Krieg verschlechterte sich die Situation allerdings noch
drastischer. |
.
Die noch aus Kriegszeit vorhandenen Bestände waren mittlerweile
erschöpft. Die Neuproduktion war aufgrund der verherrenden Kriegszerstörungen,
der Demontage von Industrieanlagen durch die Alliierten und des immensen
Materialmangels noch nicht in einem ausreichenden Ausmaße angelaufen.
Aus Mangel an Säuglingswäsche wurden Neugeborene in Kliniken
sogar teilweise in Zeitungspapier gepackt, um sie auf dem Weg von der Entbindungsstation
nach Hause zu wärmen.
.
Auch die Versorgung mit anderen industriell erzeugten Verbrauchsgütern
war auf ein Bruchteil der Produktion der Vorkriegszeit reduziert. Verschleiß
an Hausrat, Werkzeugen, Maschinen war daher kaum ersetzbar. Es herrschte
selbst Mangel an Kleinigkeiten wie Streichhölzern, Schuhcreme, Schuhbändern,
Stopf- und Nähgarn, Rasiermesser, Seife, etc.
.
 Wohnhaus in Hamburg
Wohnhaus in Hamburg
|
. |
Besonders schlimm traf die Bevölkerung im zerstörten Deutschland
darüber hinaus die Wohnungsnot. Millionen Deutsche benötigten
als Flüchtlinge, Evakuierte und Ausgebombte eine Unterkunft. |
. |
 Luftaufnahme vom kriegszerstörten Hamburg
Luftaufnahme vom kriegszerstörten Hamburg
|
.

Kellerwohnung in Hamburg. Das eine Zimmer wird von
zwei Familien mit insgesamt 12 Personen bewohnt, Juli 1946.
|
... |
Aber ein Großteil der Wohnungen, inklusive der hygienischen
Einrichtungen war zerstört. Vielfach gab es keine Wasser-, Gas- und
Stromversorgung mehr.
Wohnungen wurden zwangsweise zugewiesen und oft lebten 5 und mehr
Personen in 1-2 Zimmern. Zusätzlich wurden als Notbehelf Barackenlager
aus Wellblech, sogenannte Nissenhütten, errichtet. |
.
| Dass die Probleme auch 1947 noch nicht gelöst waren, zeigen
die Proteste und Demonstrationen gegen die schweren Versorgungsmängel,
die es Anfang 1947 bis April 1947 in allen Ländern der
Bizone (amerikanisch-britischen Zone) gab. |
|
|
.
Im Bericht des Arbeitsamtes Ludwigsburg an die vorgesetzte Behörde
wird die Situation Ende Januar 1947 folgendermaßen beschrieben:
„Der Hungerruf, ausgehend von Rhein und Ruhr,
pflanzte sich, die Furchtgefühle der breiten Massen um das nackte
Dasein weckend, unheilverkündend in dem ganzen Gebiet der britisch-amerikanischen
Zonen fort. Die überall in Ordnung durchgeführten Streiks – übrigens
keine direkte Möglichkeit auch nur das Geringste mehr zu erzeugen
– werden keineswegs, wie in aller Welt üblich, um eine Erhöhung
des Lohneinkommens oder um die Verkürzung der Arbeitszeit schlechthin
geführt, sie berühren vielmehr die Grundlagen jeglicher Arbeit.
Der Bogen der Entbehrungen ist für weite Kreise überspannt. Es
fehlen geradezu den ehrlich arbeitenden, den die Gesetze achtenden Werktätigen
die Voraussetzungen, unter denen allein eine harte Arbeit auf Dauer durchzuhalten
ist: nämlich die ausreichende Ernährung, die notwendige Kleidung
und mancherorts sogar die Möglichkeit zur Erholung von der schweren
Arbeit in einer menschenwürdigen Wohnung.“
..

Mannheim, Oktober 1948
.
Die Lage nach dem Krieg war ein ideales "Treibhausklima"
für den schwarzen Markt. Je größer der Mangel wurde, desto
stärker dehnte er sich aus. Es sollten mehrere Jahre nach Ende des
Krieges vergehen, bis endlich "Taten" folgten, die die Versorgungslage
derart verbesserten, dass den Schwarzmarktgeschäften schließlich
der Nährboden entzogen werden konnte.
..
Copyright © 2008 LG3949.de
|