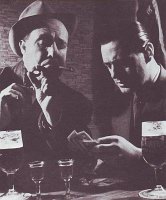Die Schwarzmarktzeit 1945-1948
.
Erscheinungsformen des Schwarzmarktes
.
| Nach dem Krieg lebten die Formen des schwarzen Kleinverkehrs aus
der Kriegszeit fort. Zusätzlich entstanden aber darüber hinaus
kurz nach dem Krieg sogar öffentliche Märkte des Schwarzhandels.
Diese erfuhren eine räumliche Institutionalisierung auf Straßen,
Plätzen und vor Bahnhöfen. Sie wurden bald zur festen Einrichtung
für jedermann zugänglich und wurden von den Behörden meist
gezwungenermaßen geduldet.
Rechtes Bild: Schwarzmarkt im Barackenlager ehemaliger
ausländischer Zwangsarbeiter |
.. |
 |
.

Schwarzmarkt vor dem Berliner Reichstag |
.. |
Die bedeutendsten öffentlichen Schwarzmarktzentren nördlich
des Mains waren Berlin, Hamburg, Hannover, Düsseldorf und Frankfurt
am Main. Auch kleinere öffentliche Märkte (meist am Bahnhof)
bildeten sich im Verlaufe des Jahres in Städten mit unter 100 000
Einwohnern.
Es wurden zwar immer mal wieder Razzien gegen diese institutionalisierten
Märkte geführt, aber insgesamt mit geringem Erfolg. In der Regel
verlagerte sich der Schwarzhandel höchstens in eine andere Straße. |
.
Wie eine erste Begegnung mit dem Schwarzmarkt aussehen konnte, schildert
Siegfried Lenz in „Lehmann’s Erzählungen. Aus den Bekenntnissen
eines Schwarzhändlers“:
| „Sie gingen vorbei, ohne einander anzusehen,
mit vorgegebener Gleichgültigkeit. Niemand schien in Eile. Auch ich
ging die Straße hinab, schlenderte wie die anderen. War das der Markt,
den ich erträumt hatte? Wo war das Geheimnis, wo der Vorteil? Und
wie erfolgte der Handel? Aufmerksam ging ich weiter, und dann, ja, dann
merkte ich es: ich hörte die Vorübergehenden leise sprechen,
es klang wie Selbstgespräche, so daß ich an Kinder denken mußte,
die, wenn man sie zum Einkaufen schickt, unaufhörlich wiederholen,
was sie mitbringen sollen: einen Liter Milch, einen Liter Milch ... |
... |
 |
.
 |
... |
Auch die Leute, die sich hier gelassen aneinander
vorbeischoben, wiederholten unaufhörlich denselben Spruch, als fürchteten
sie, sie könnten ihr Stichwort vergessen. Ich hörte genau hin,
hörte Stimmen, die im Vorbeigehen ehrgeizlos „Brotmarken“ oder „Nähgarn“
flüsterten, hörte eine Frau, die mit gesenktem Blick nur ein
einziges Wort sagte: „Marinaden, Marinaden“, ein Greis murmelte: „Bettzeug,
ein rotgesichtiges Mädchen: „Amis“. Jede Stimme empfahl ehrgeizlos
etwas anderes: Schuhe, Fischwurst, Stopfnadeln – vielleicht waren es die
vom Nordkap-, Uhren, Schinken, Kaffee und Eipulver. Niemand gab sich aufdringlich
marktschreierisch – wie wohltuend war doch die Diskretion meines Marktes. |
.
| Ich empfand, während ich leise „Sahnelöffel,
Sahnelöffel“ zu flüstern begann, die tiefere Bedeutung dieses
Vorgangs: die Nachfrage übertraf das Angebot bei weitem, der Mangel
triumphierte, bestimmte den Kurs, und die Zeitgenossen bewiesen, daß
sie dem Mangel gewachsen waren. Eine Revision der alten Werte hatte stattgefunden,
die Not setzte den Preis fest. Man bezog, was man gerade effektiv braucht,
und nicht, was man zu brauchen glaubte – nicht mehr. Der unmittelbare Bedarf
hatte Vorrang. Die Bezahlung wurde von gegenwärtigem, nicht von zukünftigem
Verlangen bestimmt, und was besonders zu Ehren kam, war die uralte Praxis
der ersten Märkte -–der Tausch.“ |
... |
 |
.
An Stellen, wo die Razzien besonders umfangreich durchgeführt
wurden, kam es oft zu einer Dezentralisierung oder Aufsplitterung des Handels.
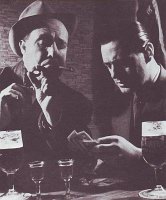 Gasthausgeschäft
Gasthausgeschäft
bei Bier und Korn
|
.. |
In München brachten viele Schwarzhändler zum Beispiel
nur geringe Warenmengen zu den Umschlagplätzen mit, um den Verlust
durch Beschlagnahmung bei Razzien möglichst klein zu halten. Sie postierten
allerdings Mittelsmänner in Marktnähe mit einem weiteren Warenvorrat,
auf den bei Bedarf zurückgegriffen werden konnte.
Es wurde auch gerne dazu übergegangen anstelle des Straßengeschäftes
den Geschäftsabschluss in Gasthäusern („Schwarzer Gaststättenhandel")
oder Privatwohnungen zu tätigen und die Warenübergabe dann für
einen späteren Zeitpunkt zu vereinbaren. |
.
Je tiefer die bewilligten Lebensmittelrationen unter das physische
Existenzminimum sanken und je höher der Mangel an wichtigsten Gebrauchsgütern
und Heizmaterial war, desto stärker dehnte sich der Schwarzmarkt aus.
.

Schwarzmarkt in Hamburg,1946 Alte Frau verkauft Streichhölzer.
|
... |
Die Not zwang selbst ehrbare Bürger, die sich zuvor im Leben
nie etwas zu Schulden hatten kommen lassen, in die Illegalität des
Schwarzmarktes.
Fast alle machten mit - mussten mitmachen, um zu überleben:
Greise, Väter, Mütter, Kinder ... |
.. |

Schwarzmarktszene am Berliner Reichstag
|
.
| Viele kleine Schieber waren ehemalige Fremdarbeiter (klassifiziert
als displaced
persons), da diese bei den Rationen in Ernährung und Gütererwerb
besser gestellt waren und dadurch die Möglichkeit hatten, für
sie überschüssige Ware gewinnbringend auf dem Schwarzmarkt einzutauschen.
Selbst viele alliierte Soldaten aller Besatzungszonen beteiligten
sich am Schwarzhandel. Gerade wer Nichtraucher war, konnte dort die von
der Armee zugeteilten Zigarettenrationen gegen kostbare Wertgegenstände
eintauschen. |
.... |

Russischer Soldat, der gleich 3 Armbanduhren "erbeutet"
hat.
|
.
 Das Berliner Schieberehepaar Manke mit seiner
zum größten Teil verdorbenen Schieberware
Das Berliner Schieberehepaar Manke mit seiner
zum größten Teil verdorbenen Schieberware
|
.... |
Die exorbitanten Gewinne, die sich auf dem Schwarzmarkt erzielen
ließen, führten dazu, dass bald eine Schicht hauptberuflicher
Schieber entstand.
Selten bewahrheitete sich folgender Spruch so sehr wie in der Schwarzmarktzeit:
„Und ist der Handel noch so klein, bringt
er mehr als Arbeit ein.“ |
.
| Um dem Problem des illegalen Schwarzmarktes zu begegnen, wurden
seit Sommer 1945 im Einvernehmen mit den Besatzungsmächten offizielle
Tauschmärkte, Tauschläden und Tauschzentralen/ -ringe (wie es
sie zum Teil auch schon in letzen Kriegsjahren gegeben hatte) eingerichtet.
Allerdings war bei diesen der Handel mit Lebens- und Genußmitteln
verboten. Kontrolliert vom Wirtschaftsamt sollte der offiziell abgesegnete
Tauschverkehr die Schwarzmarktaktivitäten eindämmen. |
... |
 Berliner Tauschmarkt, Juni 1946
Berliner Tauschmarkt, Juni 1946
|
.
Aber die Maßnahme hatte nur begrenzten Erfolg, da gerade die
Waren, die am dringendsten benötigt wurden, nicht gehandelt werden
durften. Ein Großteil der Tauschgeschäfte entzog sich daher
weiterhin der staatlichen Kontrolle.
In einer Grauzone zwischen dem illegalen schwarzen Markt und dem
offiziell genehmigten Tauschhandel bewegten sich die Kompensationsgeschäfte
der Betriebe und Fabriken, auch als „grauer Markt“ bezeichnet. Bei
der Kompensation wurde Ware nicht (oder nicht allein) mit Geld bezahlt,
sondern im Zuge eines Gegengeschäftes ebenfalls mit Ware oder einer
Dienstleistung beglichen.
.
Um die Produktion wieder aufnehmen zu können, wurden von vielen
Betrieben Materialien, Ersatzteile, Werkzeuge und Maschinen benötigt,
die gegen Geld auf dem freien Markt nicht zu bekommen waren. Daher war
meist die einzige Chance die Kompensation, wobei dem Geschäftspartner
als Gegenleitung für die Lieferung nicht selten auch ein bestimmtes
Kontingent am fertigen Produkt zugesagt wurde.
| Ähnlich verhielt es sich mit den Arbeitern. Viele Arbeiter
forderten zu den Löhnen zusätzliche Zuteilung von Lebensmitteln
oder anderen Sachleistungen, die dann gerne auf dem Schwarzmarkt für
andere begehrte Waren eingetauscht wurden. Um genügend Fachpersonal
zu bekommen, wurde vor allem in der Kleineisenindustrie, der Textilindustrie
und der Kautschukindustrie diesem Wunsch in Form von „Sachwertprämien"
entsprochen.
Als Anreiz zur Produktionssteigerung wurde im Ruhrgebiet für
Bergarbeiter ein Punktesystem eingeführt (Bergmannspunkte). Die Punkte
wurden bei regelmäßiger und möglichst hoher Arbeitsleistung
angerechnet und konnten in speziellen Geschäften unter anderem gegen
Genussmittel wie Kaffee, Schnapps und Zigaretten eingetauscht werden. |
. |
|
.
Es gab zwar bereits mit dem Kontrollratsgesetz Nr. 50 vom 20.3.1947
den Versuch durch die alliierte Militärregierung die Kompensationsgeschäfte
und Sachwertprämien zu verbieten, aber durch den vehementen Widerstand
der Betriebe, Arbeiter und deutschen Behörden gelang es, Ausnahmeregelungen
durchzusetzen, die diesen „grauen Markt“ schließlich mehr oder minder
offiziell erlaubten.
.
Copyright © 2008 LG3949.de
|